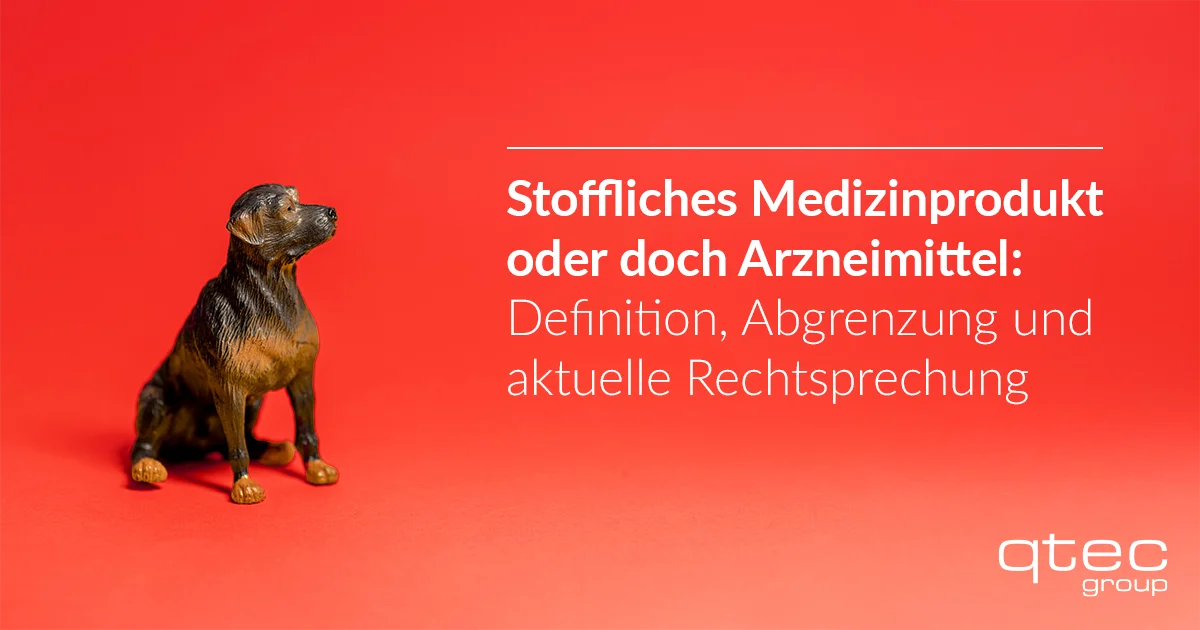
Stoffliches Medizinprodukt oder doch Arzneimittel:
Definition, Abgrenzung und aktuelle Rechtsprechung
Einleitung
Die Abgrenzung zwischen Medizinprodukt und Arzneimittel ist speziell für stoffliche Medizinprodukte mit in Kraft treten der MDR zunehmend diffiziler geworden. Außerdem stellen die weitreichenden Auswirkungen der aktuellen EuGH-Rechtsprechung die Hersteller solcher Produkte vor zusätzliche regulatorische Herausforderungen, was eine präzise Einordnung dieser Produkte unabdingbar macht.
Definition und Beispiele stofflicher Medizinprodukte
Stoffliche Medizinprodukte bestehen aus Stoffen oder einer Kombination von Stoffen und ähneln in ihrer Aufmachung und Darreichungsform häufig Arzneimitteln, sind aber Medizinprodukte. Gemäß der „Guidance on borderline between medical devices and medicinal products under Regulation (EU) 2017/745 on medical devices “(MDCG 2022 – 5) sind stoffliche Medizinprodukte solche, die:
- aus Substanzen bestehen, die für Medizinprodukte zugelassen sind, und
- ihre Hauptwirkung nicht durch einen pharmakologischen, metabolischen oder immunologischen Wirkmechanismus erzielen
Stoffliche Medizinprodukte erreichen ihre Zweckbestimmung durch physikalische und/oder mechanische Wirkmechanismen wie zum Beispiel durch die Bildung einer physikalischen Barriere, der Hydratation oder Dehydratation sowie, der Änderung des pH-Werts. Diese Abgrenzung ist entscheidend für den regulatorischen Status eines Produkts.
Zu den typischen Beispielen für stoffliche Medizinprodukte zählen:
- Salzhaltige Nasentropfen oder -sprays
- Schleimbildende Hustensäfte, Rachensprays oder Lutschtabletten
- Künstliche Tränen
- Vaginale Cremes oder Gele zur Wiederherstellung des physiologischen Milieus
- Osmotische Abführmittel
Die Abgrenzung zu Arzneimitteln
Funktionsarzneimittel vs. Präsentationsarzneimittel
Die Pharma-Richtlinie 2001/83/EG unterscheidet in Artikel 1 zwei Szenarien, die ein Produkt per Definition zu einem Arzneimittel machen, welche man Allgemein hin, aber ausdrücklich nicht in der Richtlinie, als sogenannte „Präsentationsarzneimittel“ (Art. 1 Nr. 2 Buchst. a) bzw. „Funktionsarzneimittel“ (Art. 1 Nr. 2 Buchst. b) bezeichnet.
Präsentationsarzneimittel
Gemäß Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe a der Richtlinie 2001/83/EG sind Präsentationsarzneimittel "Alle Stoffe oder Stoffzusammensetzungen, die als Mittel mit Eigenschaften zur Heilung oder zur Verhütung menschlicher Krankheiten bestimmt sind".
Ein Erzeugnis gilt dann als ein Präsentationsarzneimittel, wenn es:
- ausdrücklich als Mittel mit Eigenschaften zur Heilung, Linderung oder Verhütung von Krankheiten bezeichnet oder empfohlen wird, oder
- bei einem durchschnittlich informierten Verbraucher auch nur schlüssig, aber mit Gewissheit den Eindruck erweckt, dass es in Anbetracht seiner Aufmachung entsprechende Eigenschaften haben müsse.
Der Begriff der "Bestimmung" ist nach der Rechtsprechung des EuGH weit auszulegen.
Funktionsarzneimittel
Funktionsarzneimittel sind gemäß Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe b der Richtlinie 2001/83/EG "alle Stoffe oder Stoffzusammensetzungen, die im oder am menschlichen Körper verwendet oder einem Menschen verabreicht werden können, um entweder die menschlichen physiologischen Funktionen durch eine pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkung wiederherzustellen, zu korrigieren oder zu beeinflussen oder eine medizinische Diagnose zu erstellen“.
Funktionsarzneimittel nehmen durch ihre Wirkung aktiv Einfluss auf physiologische Funktionen. Die Einstufung als Funktionsarzneimittel setzt voraus, dass die pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkung des Produkts wissenschaftlich nachgewiesen ist.
Wesentliche Unterschiede in der regulatorischen Einordnung
Die Unterscheidung zwischen stofflichen Medizinprodukten und Arzneimitteln hat erhebliche regulatorische und wirtschaftliche Konsequenzen:
- Zulassungsverfahren: Arzneimittel benötigen eine arzneimittelrechtliche Zulassung gemäß § 21 Abs. 1 AMG, während für Medizinprodukte je nach Klassifizierung verschiedene Konformitätsbewertungsverfahren gelten.
- Klinische Studien: Für Arzneimittel sind meist umfangreichere und kostspieligere klinische Studien erforderlich, die für neuartige Wirkstoffe normalerweise im 3-stelligen Millionenbetrag (Out-of-Pocket cost) liegen. Dies ist bei Medizinprodukten in der Regel nicht der Fall. Ausnahmen hiervon können bei Hochrisikoprodukten der Klasse III auftreten.
- Werbemöglichkeiten: Für Medizinprodukte gilt, allgemein gesprochen, eine weniger strenge Reglementierung der Bewerbung der Produkte, zum Beispiel bezüglich der Pflichtangaben, der Verbote bestimmter Werbeinhalte und Einschränkungen bei der Krankheitswerbung.
Wegweisendes EuGH-Urteil vom 19. Januar 2023
Der Europäische Gerichtshof hat im Januar 2023 in den verbundenen Rechtssachen C-495/21 und C 496/21 ein wichtiges Urteil bezüglich der Abgrenzung zwischen Medizinprodukten und Arzneimitteln gefällt. Der Gerichtshof stellte folgende zentrale Grundsätze fest:
Fehlende wissenschaftliche Nachweise: „Somit kann bei Fehlen wissenschaftlicher Erkenntnisse, […], dass die bestimmungsgemäße Hauptwirkung im oder am menschlichen Körper weder durch pharmakologische oder immunologische Mittel noch metabolisch erreicht wird, ein Erzeugnis nicht als „Medizinprodukt“ […] eingestuft werden.“
Rolle der nationalen Gerichte: Bei fehlender wissenschaftlicher Erkenntnis über den Mechanismus der bestimmungsgemäßen Hauptwirkung „ist [es] Sache der nationalen Gerichte, im Einzelfall zu beurteilen, ob die Voraussetzungen für die Definition des Begriffs „Präsentationsarzneimittel“ im Sinne [von Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe a] der Richtlinie 2001/83 erfüllt sind.“
Der EuGH urteilt damit zusammenfassend wie folgt: Wenn die Hauptwirkungsweise eines Produkts wissenschaftlich nicht eindeutig bestimmt werden kann, fällt es weder in die Kategorie der Medizinprodukte noch in die der „Funktionsarzneimittel“. Stattdessen muss dann geprüft werden, ob es als „Präsentationsarzneimittel“ einzuordnen ist.
Sichern Sie sich regulatorische Sicherheit –
Klären Sie jetzt die korrekte Einordnung Ihrer stofflichen Medizinprodukte unter Berücksichtigung der aktuellen EuGH-Rechtsprechung und MDR-Vorgaben. Unser Expertenteam unterstützt Sie bei Wirkmechanismusanalyse, Klassifizierung und wissenschaftlicher Dokumentation – praxisnah, fundiert und konform.
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Erstgespräch!
Auswirkungen für Hersteller
Diese Rechtsprechung stellt Hersteller stofflicher Medizinprodukte vor neue Herausforderungen. Die Medical Device Regulation hatte den Status dieser Produkte durch die Regeln 21 und 3 zwar ausdrücklich anerkannt, doch durch die neue Rechtsprechung könnte vielen Bestandsprodukten nun der Status als Medizinprodukt aberkannt werden.
Besonders kritisch ist die Situation für Produkte mit pflanzlichen Inhaltsstoffen, deren Wirkmechanismus oft komplex und wissenschaftlich nicht immer vollständig geklärt ist. Wichtige Hinweise hierzu finden sich im bereits erwähnten MDCG 2022-5 Dokument.
Lösungsansätze und Strategien für Hersteller
Trotz der regulatorischen Herausforderungen gibt es verschiedene Strategien, mit denen Hersteller den Status ihrer Produkte als Medizinprodukte schützen können:
- Wissenschaftlicher Nachweis des Wirkmechanismus
Für stoffliche Medizinprodukte ist es entscheidend, eine solide wissenschaftliche Dokumentation zu erstellen, die klar belegt, dass der primäre Wirkmechanismus physikalisch oder chemisch und nicht pharmakologisch, immunologisch oder metabolisch ist. - Management pflanzlicher Inhaltsstoffe
Für Produkte mit pflanzlichen Zubereitungen oder Extrakten sollte anhand aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse nachgewiesen werden, dass die Pflanzen-Inhaltsstoffe unter Berücksichtigung von Zusammensetzung, Zubereitung, Dosierung und Indikation vorwiegend physikalisch wirken. Ein erster Ansatz kann der Abgleich mit etwaigen EU-Monografien sein. - Bewertung von Hilfsstoffen
Hersteller können wissenschaftlich nachweisen, dass diese Stoffe aufgrund ihrer geringen Menge keine unterstützende Wirkung im Sinne der Zweckbestimmung haben und daher nicht zur Einstufung als Arzneimittel oder zur Hochstufung in Medizinpodukte Klasse III führen sollten. Für Aroma-, Farb-, Duft- und Konservierungsstoffe bietet die MDCG 2022-5 einen Ansatzpunkt. - Produktpräsentation überprüfen
Um eine Einstufung als „Präsentationsarzneimittel“ zu vermeiden, sollten Hersteller die Präsentation ihrer Produkte, einschließlich Kennzeichnung, Gebrauchsanweisung und Marketingmaterialien, sorgfältig überprüfen und sicherstellen, dass diese nicht den Eindruck erwecken, Arzneimitteleigenschaften zu haben.
Ausblick: Entwicklungen in der EU
Die Europäische Kommission hat im April 2023 im Rahmen der umfassenden Reform der europäischen Arzneimittelgesetzgebung (EU-Pharmapaket) einen Vorschlag für einen neuen Mechanismus zur Klassifizierung von Grenzprodukten vorgelegt. Dieser soll dazu beitragen, frühzeitig im Entwicklungsprozess zu klären, ob ein Produkt als Arzneimittel oder als Medizinprodukt einzustufen ist.
Fazit
Die Abgrenzung zwischen stofflichen Medizinprodukten und Arzneimitteln bleibt ein komplexes Feld, das durch das EuGH-Urteil vom Januar 2023 zusätzliche Komplexität erhalten hat. Die Entscheidung stellt klar, dass ohne wissenschaftlich festgestellte Hauptwirkungsweise ein Produkt nicht als Medizinprodukt eingestuft werden kann.
Für Hersteller stofflicher Medizinprodukte ist es wichtiger denn je, den Wirkmechanismus ihrer Produkte wissenschaftlich fundiert nachzuweisen und ihre Produktpräsentation kritisch zu prüfen, um den Status als Medizinprodukt zu schützen.
Da die Entscheidung über die Einstufung eines Produkts im Einzelfall unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren getroffen werden muss, empfiehlt es sich für Hersteller, proaktiv zu handeln und frühzeitig die wissenschaftliche Dokumentation ihrer Produkte zu überprüfen und zu aktualisieren.
Die geplante Einführung eines neuen EU-Mechanismus zur Klassifizierung von Grenzprodukten könnte in Zukunft mehr Klarheit bringen und den Herstellern helfen, regulatorische Risiken frühzeitig zu erkennen und zu minimieren. Wobei die Hersteller davon ausgehen müssen, dass der Begriff der „pharmakologischen Wirkung“ in Zukunft sicher eher weiter als enger gefasst werden wird, wie das auch bereits im Urteil vom 13. 3. 2025 in der Rechtssache C-589/23 der Fall war.





